Eskapismus, Kunst, spielerisches Bewältigen von Herausforderungen oder einfach nettes Beisammensein mit Freunden – alles Facetten von Rollenspielen und gleichsam wohl die häufigsten Gründe, diese Spiele zu betreiben. Sicherlich nicht zu den wünschenswerten Erfahrungen zählt jedoch interpersonelles Drama auf der Out-of-game-Ebene, doch wie alle anderen menschlichen Gruppenaktivitäten, so ist auch das Rollenspiel leider nicht gefeit vor Streit, Intriganz, Konkurrenzdenken, Neid, Kontrollkämpfen, Diskriminierung, gekränktem Stolz und schließlich einfachen Meinungsverschiedenheiten.
Längst nicht alle Spielgruppen bewältigen solche Probleme schnell und effektiv, manche überhaupt nicht. Für die betroffenen Teilnehmer bedeutet dies, dass bei Spielsitzungen klar der realweltliche Stress mit den Mitspielern in den Vordergrund tritt und Entspannung und Freude am gemeinsamen Spiel so gut wie gar nicht aufkommen. Wenn nicht gleich öffentlich die Fetzen fliegen, so machen viele über längere Zeit gute Miene zu bösem Spiel und fressen Ärger und Frust in sich hinein. Das eigentlich so großartige und befreiende Hobby Rollenspiel wird zur Bühne für die scheußlichste Art von Drama: für den zwischenmenschlichen Konflikt. Was auf Ebene von Spieler- und Nichtspielercharakteren hochinteressant und motivierend sein kann, ist, wenn es stattdessen unter den Spielern stattfindet, überaus kontraproduktiv und auf kurz oder lang auch destruktiv. Realweltliches Drama am Rollenspieltisch ist also immer schlecht und sollte immer so schnell wie möglich gestoppt werden – die Frage ist nur: wie?
Das Problem identifizieren
Man sollte denken, dass Probleme oder Konflikte im Rollenspiel auch immer schnell als solche zu erkennen sind, schließlich sitzt man bei jedem Treffen gemeinsam über mehrere Stunden am Tisch (oder am VTT) und betreibt ohnehin ein Spiel, das vor allem über Kommunikation funktioniert. Diese Logik greift jedoch zu kurz, denn manchmal brodelt etwas nur unter der Oberfläche, kocht allerdings nicht offen und für alle deutlich merklich über. Ratsam ist es trotzdem, auch vor einem solchen Überkochen bereits aufmerksam auf vorhandene Störfaktoren und Schwierigkeiten zu werden und diese schnellstmöglich mit der Gruppe oder zumindest den betreffenden Mitspielerinnen zu thematisieren. Dazu muss das Problem bzw. müssen die Probleme jedoch erst mal identifiziert werden – und zwar nicht nur in der Symptomatik, sondern auch in der Ursache. Gerade neueren Rollenspielern wird dies aufgrund eines noch recht kleinen Erfahrungsschatzes mit Spielsituationen, alternativen Umsetzungsmöglichkeiten und den vielen kleinen Nuancen oft nicht leichtfallen, doch auch bei erfahrenen Spielern kann dies letztlich eine Frage der Menschenkenntnis sein.
Hier eine Auflistung einiger typischer konkreter Problem- oder Konfliktsituationen, die den meisten sicherlich aus eigenen Spielgruppen bekannt vorkommen werden. Möglicherweise mag ihre Nennung dennoch dem einen oder der anderen dabei helfen, aktuell oder zukünftig vorhandene Schwierigkeiten im Spiel zu erkennen oder genauer einzuschätzen. Folgende Situationen signalisieren in jedem Fall ein Problem, das thematisiert und gelöst werden muss:
- Eine Mitspielerin wird beleidigt, bloßgestellt, diskriminiert oder gemobbt. Dies kann auch indirekt durch Andeutungen, spitze Bemerkungen oder zu harsche Kritik geschehen.
- Spielsituationen werden als von der SL zu schwer oder unfair gestaltet empfunden.
- Der Abenteuer- oder Kampagnen-Plot wird als nicht spannend oder interessant genug empfunden.
- Der Spielleiter sperrt sich gegen Wünsche und Vorschläge seiner Mitspielerinnen.
- Der Spielleiterin wird mangelnder Realismus oder mangelnde Ausgewogenheit in bestimmten Regelungen oder der Umsetzung von Situationen vorgeworfen.
- Eine der Spielerinnen möchte selbst Spielleiterin werden und versucht, dies durch direkte oder indirekte Kritik am aktuellen Spiel bzw. der aktuellen Spielleitung zu erwirken.
- Eine Spielerin übt Kontrolle über die Handlungen oder Spielweisen der anderen Teilnehmerinnen aus.
- Zwei oder mehr Teilnehmer haben völlig andere Ansichten über die angemessene oder „gute“ Darstellungsweise von Spieler- oder Nichtspieler-Charakteren.
- Eine Spielerin ist viel zu aktiv und drängt sich immer wieder in den Vordergrund.
- Ein Spieler ist zu wenig aktiv und handelt fast nur passiv.
- Gewisse Spielinhalte sind für bestimmte Teilnehmer äußerst unangenehm, erzeugen Schamgefühle, verletzten oder deprimieren sie.
Diese besonders häufigen Problemfälle treten natürlich in allen möglichen Abwandlungen und Kombinationen auf. Als generelle Faustregel lässt sich sicherlich sagen, dass immer dann ein echtes Problem im Spiel vorliegt, wenn ein oder mehrere Teilnehmer (Spieler oder Spielleiterin) über längere Zeit (über mehr als eine Spielsitzung hinweg) frustriert, gekränkt oder schwer gelangweilt sind. Fällt einem dies auf oder ist man selbst die Betroffene, sollte der Weg des Gesprächs gesucht werden. Im Zweifelsfall ist es da auch besser, den Sachverhalt lieber etwas vorschnell als bereits in einem fortgeschrittenen Stadium zu thematisieren. In einen Alarmismus sollte man dennoch nicht verfallen, sondern das Spiel und die Mitspieler lieber aufmerksam mit gleichzeitiger Selbstkritik beobachten.
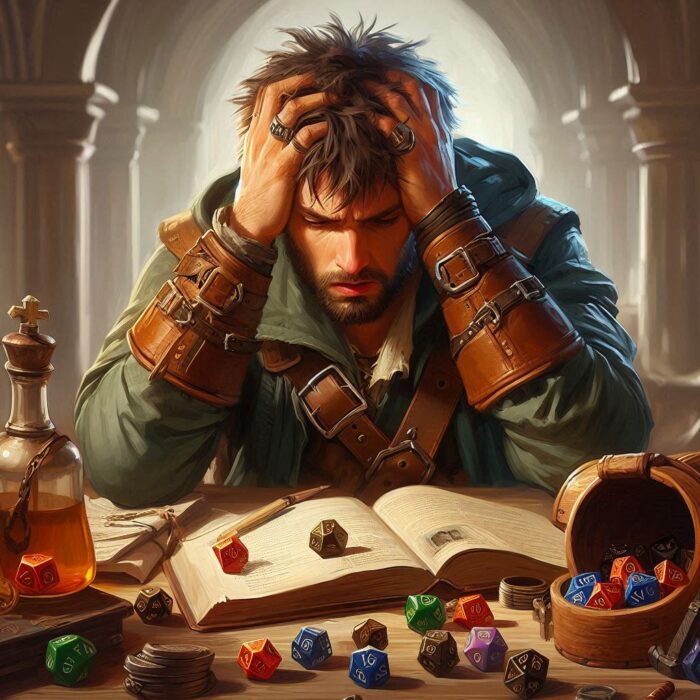
Die erste Entscheidung: Gruppengespräch oder Einzelgespräch?
Wenn einer Teilnehmerin (egal ob Spielleiterin oder Spielerin) ein Problem auffällt oder sie direkt betroffen ist, sollte sie in jedem Fall den Weg des Gesprächs wählen. Wann und unter welchen Bedingungen dieses Gespräch stattfindet, sollte jedoch wohlüberlegt sein. Während der erste Impuls vermutlich häufig darin besteht, das Problem unmittelbar und mit der gesamten Gruppe zu besprechen, ist das nur manchmal, aber eben nicht immer der richtige Weg. Es gibt Fälle, die mehr Vorsicht und Rücksicht erfordern und in denen ein Gespräch unter vier Augen die beste Wahl ist. Letztere liegen vor allem dann vor, wenn die betroffene(n) Person(en) als sensibler eingeschätzt wird/werden und man vermeiden möchte, sie vor dem Rest der Gruppe bloßzustellen. Ein weiterer Grund kann in der Einschätzung bestehen, dass das wahrgenommene Problem vor allem etwas mit dem ganz individuellen Empfinden und den eigenen Spielbedürfnissen zu tun hat und vermutlich vom Rest der Gruppe nicht so gesehen wird. Im Zweifelsfall kann es generell nicht schaden, zunächst grundsätzlich ein Einzelgespräch nur unter den direkt betroffenen Teilnehmern zu führen und dieses bei Bedarf – und wenn alle zustimmen – in der gesamten Gruppe zu wiederholen.
Schätzt man die Lage aber so ein, dass es für keinen der Betroffenen besonders unangenehm ist, wenn das Gespräch direkt mit der gesamten Gruppe gesucht wird, und wenn das zu Besprechende ohnehin weniger mit persönlichen und individuellen Vorgehensweisen, sondern mehr mit der gemeinsamen Spielweise und dem Erlebnis als Ganzes zu tun hat, kann gleich ein Gruppengespräch geführt werden. Manchmal mag das auch die bessere Wahl sein, damit sich einzelne Teilnehmer nicht übergangen fühlen und nicht der Eindruck erweckt wird, Gruppenangelegenheiten würden an ihnen vorbeientschieden.
Die Abwägung, ob nun ein Gruppen- oder Einzelgespräch gesucht wird, ist also keineswegs immer einfach. Doch sollte man sich die Zeit nehmen, hier die bestmögliche Wahl zu treffen, um die Gefahr zu minimieren, dass sich Mitspieler öffentlich kritisiert fühlen. Wie gesagt: Im Zweifelsfall sollte zunächst die Wahl auf das Einzelgespräch fallen. Das so Besprochene kann danach wenn nötig immer noch mit der Gruppe geteilt werden.
Der richtige Zeitpunkt
Beinahe ebenso wichtig wie die Wahl zwischen Gruppen- oder Einzelgespräch ist die Entscheidung, wann die Angelegenheit zur Sprache gebracht wird. Auch hier gibt es häufig einen starken Impuls: sofort während der Spielsitzung. Meistens ist dies jedoch genau die falsche Entscheidung. Wenn es sich nicht gerade um ein äußerst massives oder akutes Problem handelt – z. B. eine Mitspielerin beleidigt oder diskriminiert wurde oder etwas für den Spielverlauf enorm Wichtiges übersehen wurde –, sollte das Gespräch in aller Regel auf das Ende der Spielsitzung oder einen separaten Zeitpunkt verschoben werden. Erstens wird dadurch Rücksicht auf das Spielerlebnis der anderen Teilnehmer genommen, zweitens wird so die Möglichkeit eingeräumt, dass sich die zunächst als Problem identifizierte Spielsituation im Nachhinein vielleicht als doch nicht problematisch oder sogar als völlig missverstanden entpuppt. Jeder kann bei seinen Einschätzungen mal falsch liegen, und so ist eine moderate und reflektierte Reaktionsweise fast immer empfehlenswert.
Bei einem nachträglichen Gespräch gibt es dann wiederum mehrere Unteroptionen: direkt nach der Sitzung am selben Tag, vor Spielbeginn bei der nächsten Sitzung oder zu einem vollständig separaten Zeitpunkt. Um Rücksicht auf die Zeitplanung der anderen Teilnehmerinnen zu nehmen, empfiehlt sich meistens die letzte Option. Nur wenn der Sachverhalt als relativ inkomplex oder wenig schwerwiegend eingeschätzt wird, ergibt ein Gespräch am Ende der laufenden Sitzung oder zu Beginn der nächsten einen Sinn. Bei einem Einzelgespräch (siehe vorigen Abschnitt) sollte immer die dritte Zeitpunkt-Option – also das Gespräch außerhalb des Spiels bei einem separaten Termin – gewählt werden. So vermeidet man doch sehr fadenscheinige Äußerungen wie „Kann ich dich mal eben sprechen, Paul“, bei denen wohl nur ein Mit-Rollenspieler mit einem Menschenkenntnis-Wert von -5 oder weniger nicht merkt, dass was im Busch ist. Zur Rücksichtnahme gehört hier eben auch, keine Grundlage für Vermutungen bei den anderen Teilnehmern zu schaffen. Zum Einzelgespräch lädt man den/die Betroffenen am besten per Anruf oder Messenger-Nachricht außerhalb des Spiels ein und vereinbart mit ihnen einen eigenständigen Gesprächstermin. Soll mit der gesamten Gruppe gesprochen werden, kann man direkt nach der Spielsitzung einen Termin vorschlagen – oder eben auch auf einen Gruppenchat o. ä. zurückgreifen.
Liegt wirklich so richtig mal etwas im Argen – entweder was das Spiel selbst betrifft oder im Verhältnis der Spielerinnen zueinander –, dann hilft alles nichts, dann muss der sofortige Time-out während der Sitzung erfolgen. Ein Aufschub würde dann nur dem Spiel oder eben den Teilnehmerinnen schaden. Direkte oder indirekte Beleidigungen, böse Spitzen oder Diskriminierungsverhalten haben am Spieltisch nie etwas verloren und gehören immer sofort identifiziert und beanstandet. Liegt ein Missverständnis vor oder war es „nicht böse gemeint“, kann dies ja klargestellt und eine angemessene Bitte um Entschuldigung geäußert werden. Dann ist vielleicht ein Friedensschluss und ein anschließendes Weiterspielen möglich. Falls jedoch ein oder mehrere Teilnehmer tatsächlich gekränkt wurden, sollte es von allen akzeptiert und verstanden werden, falls diese das Spiel zunächst nicht fortsetzen möchten.
Bei einem größeren Problem im Spielverlauf selbst, vor allem, wenn zentrale Aspekte vergessen, übersehen oder falsch eingeschätzt wurden, kann auch ein sofortiges Pausieren und ein direktes Gespräch über den Missstand sinnvoll sein. Niemandem ist schließlich damit gedient, wenn wesentliche Bestandteile der gemeinsamen Fantasie-Erfahrung auf Inkonsistenzen gründen – auch der Spielleiterin nicht. Als Beispiel stelle man sich eine Situation vor, in der sich die SC am vergangenen Spielabend die Mithilfe einer Gruppe von NSC gesichert haben, diese Tatsache bei der gerade laufenden Sitzung jedoch bisher vergessen wurde.
Dann besteht die Möglichkeit, dass der Spielleiter (oder ein anderer Teilnehmer) die realweltlichen Grundlagen eines Sachverhalts in solcher Weise falsch einschätzt, dass damit die Spielprämisse verletzt würde. Die meisten Spielansätze orientieren sich ja (trotz Fantasy- oder Science-Fiction-Elementen) an den physikalischen, biologischen und psychologischen Bedingungen der echten Welt, und falls hier eine wirklich derbe Abweichung in den Schilderungen der SL oder den Annahmen der Spieler vorliegen sollte, dann kann das durchaus Plausibilität und Immersivität des Abenteuers oder sogar der ganzen Kampagne gefährden. Da kann es also gut und richtig sein, sofort während des Spiels den entsprechenden Hinweis auf der Meta-Ebene zu geben und – falls nötig und nicht sofort von allen akzeptiert – den Sachverhalt auch auszudiskutieren. Gerne erinnere ich mich in diesem Zusammenhang an eine DSA-Spielsituation vor etlichen Jahren zurück, in welcher der SL entschied, eine Gruppe von Reitern könne unmöglich einen mittelgroßen Fluss an einer Stelle überqueren, die weder Brücke noch Furt aufwies. Eine Spielerin wies hier darauf hin, dass Pferde sehr wohl auch dazu gebracht werden könnten, mit Reitern auf dem Rücken zu schwimmen. Dieser wichtige und angebrachte Hinweis führte dazu, dass das Abenteuer deutlich anders verlief und ein Abhängen der Reiter eben nicht so einfach möglich war.
Realismus-Kritik kann absolut sinnvoll sein und das Spiel bereichern und sogar vor derben Logik-Problemen retten. Doch gerade bei dieser Art von Einwürfen und Vorschlägen gibt es einen schmalen Grad hin zur Besserwisserei in ihrer reinsten und ekelhaftesten Form – jener Form der Kritik nämlich, die hauptsächlich der Profilierung des sie Äußernden dient und wenig bis gar nichts zum Sachverhalt oder zur Spielsituation beiträgt. Rollenspiel sollte als Bühne für die fiktiven Charaktere und die fiktive Welt dienen, keineswegs jedoch für die Egos darstellungssüchtiger Spieler. Wer ein überbordendes Bedürfnis verspürt, die anderen Teilnehmerinnen mit seinem Fach- und Trivialwissen (ob nun angelesen oder tatsächlich originär erworben) zu beeindrucken, sollte sich vielleicht als Kandidat bei einer Quizshow bewerben, seine Mitspielerinnen aber unbedingt mit solch pseudo-intellektuellem Flexing verschonen. Nicht selten sind die Einwürfe und Hinweise von vorschnellen Realismus-Kritikern zudem noch undifferenziert oder schlichtweg falsch. Was habe ich in über drei Jahrzehnten Rollenspiel schon für einen Mumpitz von mitteilungsbedürftigen vermeintlichen Weltverstehern gehört: dass auch größere Flüsse immer völlig gefahrlos zu durchschwimmen wären, dass alle Bäume leicht zu erklettern wären, dass Wildschweine Menschen niemals ernsthaft gefährlich werden könnten, dass Winde immer über Täler hinwegzögen und niemals in diese hinabwehten oder dass Atheismus eine im europäischen Mittelalter bereits weitverbreitete Haltung gewesen wäre…
Vor der Fremdkritik sollte eben immer die Selbstkritik erfolgen. Außerdem sollte die zentrale Frage sein: Nützt meine Kritik (auch wenn wirklich fundiert und in der Sache richtig) tatsächlich dem Spiel, indem sie das Geschehen plausibler und logischer macht. Ist die Antwort ja, dann ist die Kritik auch von der hochwertigen und konstruktiven Sorte, und es darf zu einem Einwurf, einem Verbesserungsvorschlag oder sogar einer Diskussion über den Sachverhalt kommen. Geht es hingegen um Kleinigkeiten ohne jede Bedeutung für den Abenteuer- oder Kampagnenverlauf, ist ein Mitteilungsverzicht zumindest während des Spiels meistens die richtige Wahl. Ist einem die Richtigstellung eines Details dennoch ein Anliegen, kann diese ja nach der Session erfolgen. Während der laufenden Sitzung eines Mystery-Abenteuers, das auf dichte Atmosphäre ausgelegt ist, halte ich beispielsweise eine Richtigstellung, dass Polaroid und nicht Kodak die erste Sofortbildkamera auf den Markt gebracht hat, für eher störend als hilfreich.
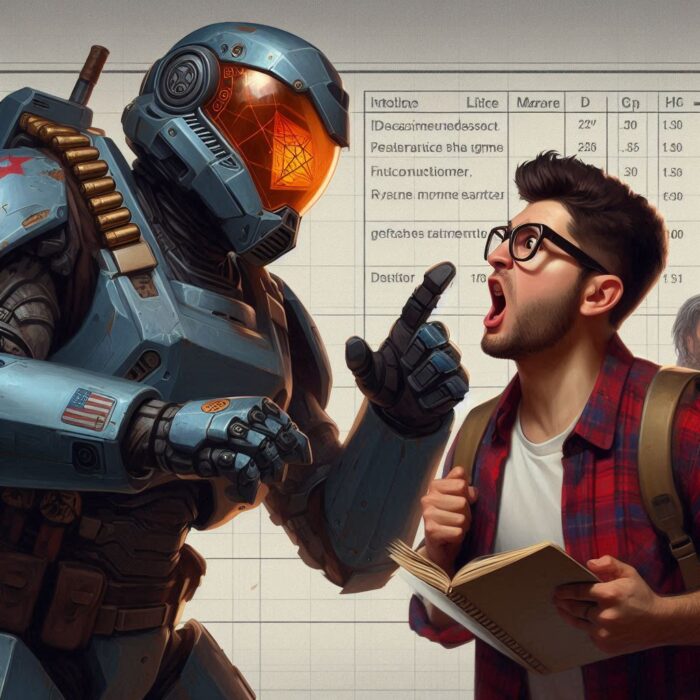
Der Weg zur Lösung
Ob Gruppen- oder Einzelgespräch und ob während des Spiels oder nachträglich – das anberaumte Lösungsgespräch sollte dann auch wirklich lösungsorientiert sein. Es sollte nicht seinen Fokus verlieren, also den eigentlichen störenden oder problematischen Sachverhalt, und auch nicht als Anlass gesehen werden, diverse zusätzliche Aspekte und Details ohne klare Verbindung zu besprechen. Hin und wieder kann es sicherlich auch nicht schaden, mit seinen Mit-Rollenspielerinnen einen allgemeinen freien Plausch über das gemeinsame Spiel und mögliche Verbesserungsvorschläge und Spielideen abzuhalten, aber im Falle eines wirklich konkreten Problems oder Konflikts sollte unbedingt erst mal dieses Thema zufriedenstellend geklärt werden.
Die eigentliche Lösungsfindung besteht dann, wie schon angesprochen, in der Findung und Etablierung möglichst guter und einvernehmlicher Kompromisse. Kompromisse sind selten beliebt und verleihen oft den Anschein von nicht vollständig zuende gedachter Notdürftigkeit. Dennoch: Es handelt sich bei ihnen um die einzig probate Einigungsmethode bei Meinungsverschiedenheiten und abweichenden Ansichten. In sozialen Kontexten ist die Kompromisssuche das Mittel der Wahl, denn alles andere würde ja bedeuten, dass sich manche Teilnehmerinnen über andere erheben und ihnen ihre Perspektive aufzwingen wollen.
Folgendes Kompromissverhalten ist zur Lösung von Rollenspiel-Problemen oft angebracht und zielführend:
- Ein oder mehrere Teilnehmerinnen modifizieren ihre realweltlichen Verhaltensweisen gegenüber den anderen Teilnehmern.
- Ein oder mehrere Teilnehmerinnen modifizieren Aspekte ihrer Spielweise – ohne jedoch das aufzugeben, was ihnen selbst am Rollenspiel wesentliche Freude bereitet.
- Ein oder mehrere Teilnehmerinnen modifizieren Aspekte ihrer Darstellung und ihres Schauspiels von SC oder NSC – wiederum ohne Vorgehensweisen aufzugeben, die ihnen wesentlichen Spielspaß bereiten.
- Die Spielleiterin modifiziert Aspekte ihrer Spielführung oder ihrer Regelnutzung.
- Die Spielleiterin modifiziert ihre Art, Plots, Szenarien oder Herausforderungen für das Spiel zu gestalten.
Natürlich kann der seltene glückliche Fall vorliegen, dass die betroffenen Spielerinnen durch das Gespräch Unklarheiten und Missverständnisse vollständig ausräumen können und schließlich zu einer kompletten Einigung in den besprochenen Fragen kommen. Solche besonders erfolgreichen Situationen kommen vor, sollten allerdings nicht die Erwartungshaltung der Gruppe an das Gespräch widerspiegeln. Viel eher sollte von der wesentlich wahrscheinlicheren Alternative ausgegangen werden, dass es zu einer Übereinkunft nur durch gewisse Zugeständnisse kommen kann, die sicherlich nicht zu hundert Prozent der persönlich favorisierten Spielweise entsprechen werden.
Eigentlich braucht das Lösungsgespräch keinen Moderator, wenn alle sich an die goldene Regel halten, die jeweils anderen Involvierten wirklich vollständig ausreden und ihren Standpunkt schildern zu lassen und das Gespräch insgesamt höflich und achtsam zu führen. Im Eifer des Gefechts, wenn die Emotionen Oberhand gewinnen oder man hartnäckig aneinander vorbeiredet, kann es dennoch empfehlenswert sein, dass eine Teilnehmerin die Kommunikation reguliert und die vorgebrachten Standpunkte und Argumente vermittelt. Normalerweise ist es am besten, wenn das die Spielleiterin übernimmt. Zwar ist es mitnichten so, dass die SL auch außerhalb von Spielrelevantem die hauptsächliche Entscheidungsträgerin wäre, doch für gewöhnlich sind die anderen Gruppenmitglieder eher bereit, bei ihr eine moderierende Funktion zu akzeptieren, zumal sie diese bereits aus dem Rollenspiel gewohnt sind.
Idealerweise reicht ein Gesprächstermin aus, um das jeweilige Problem zu lösen. Allerdings sollte ein Ergebnis nicht auf Biegen oder Brechen erzwungen werden, nur, um ja keine zusätzliche Spielzeit opfern oder einen weiteren Termin für die Angelegenheit finden zu müssen. Das Herunterspielen, Überspielen oder Ignorieren von Problemen löst diese schließlich nicht, sondern verschiebt höchstens die Momente, in denen es zur Explosion kommt. Im Zweifelsfall müssen einfach mehrere reguläre Spielsitzungen geopfert werden, um die gerade anstehenden Schwierigkeiten in Gruppe oder Spiel zu beseitigen. Wer sich hier querstellt, auf den Verlust seiner heiligen Feierabend- oder Wochenendunterhaltung verweist oder die Notwendigkeit solcher Gespräche infrage stellt, ist selbst Teil des Problems oder behindert zumindest die Lösungsfindung.
Das tatsächliche Rollenspiel sollte erst fortgesetzt werden, wenn eine Lösung oder zumindest eine gute Chance auf eine Lösung gefunden wurde. Manches muss sich schließlich erst in der Praxis behaupten, was zuvor in der Theorie für wirkungsvoll befunden wurde. Dauert die Suche nach einer Reparatur des gemeinsamen Rollenspiels nur wenige Stunden, ist das prima. Dauert sie aber mehrere Wochen oder gar Monate, ist das ebenfalls zu akzeptieren.
Eine Frage der Perspektive
Längst nicht alles, was einen oder mehrere Mitglieder einer Rollenspielgruppe am gemeinsamen Spiel stört, liegt am vermeintlich suboptimalen Spielstil der jeweils anderen Teilnehmer. Gar nicht selten ist hier auch die eigene Perspektive auf und Erwartungshaltung an das Spiel hauptverantwortlich. Möglicherweise gründet sie auf einem geringeren oder einfach abweichenden Erfahrungsschatz mit Spielsystemen, -welten und -prämissen; möglicherweise hat man eine andere Sensibilität für künstlerische Elemente, für Schauspielerei, für Storys und Dramaturgie; vielleicht einen anderen Sinn für Abstraktion oder Konkretisierung; oder möglicherweise machen einem einfach andere Dinge Spaß als einer oder mehreren anderen Personen am Spieltisch. Über diese Möglichkeiten sollte man reflektieren, bevor man eine Spielsituation oder gar das Spielerlebnis als Ganzes zum Problemfall erklärt.
Wichtige Klarstellung: Ganz ausdrücklich beziehe ich mich bei diesem Blickwinkel auf (vermeintliche) Störfaktoren, die das Spiel selbst betreffen, nicht etwa auf Probleme auf Spielerebene. Verletzendes oder kontrollierendes Sozialverhalten eines oder mehrerer Teilnehmer ist immer ein Grund zur Thematisierung. Im nächsten Abschnitt gehe ich gesondert auf diesen Fall ein.
Was jedenfalls wahrgenommene Unzulänglichkeiten in Regelnutzung, Weltschilderung, Spielleitungsstil oder Charakterdarstellung betrifft, so kann hier häufiger auch eine genauere Analyse und anschließende Modifikation der eigenen Perspektive zielführend sein. Es ist immer möglich, dass die eigene Erwartungshaltung unrealistisch oder viel zu spezifisch subjektiv ist oder die persönliche Einschätzung von Mitspielerinnen oder Spielsituationen auf unpassenden, nicht zu Ende gedachten oder schlicht falschen Annahmen gründet. So mächtig Intuition auch sein mag und so gerne wir uns vor allem in sozialen, spielerischen und kreativen Kontexten auf sie verlassen, so sehr kann sie einen manchmal auch in die Irre führen und die eigene Beurteilung ungerecht werden lassen. Daher schlage ich vor, sich vor einer Kommunikation des empfundenen Missstandes gegenüber den Mitspielerinnen selbst mit folgender wichtiger Frage zu konfrontieren: Liegt es vielleicht gar nicht an den anderen Spielern bzw. der Spielleiterin, sondern liegt es an mir selbst?
Vielleicht sieht man selbst etwas zu eng, zu speziell, zu einseitig oder ist einfach zu vorschnell mit dem Urteil. Lautet die auf ehrlicher Selbstreflexion gründende Antwort hier „ja“ oder zumindest „vielleicht“, dann sollte über eine Anpassung der eigenen Sichtweise nachgedacht werden. Meistens geht es hier eher um Detailfragen als um einen rollenspielerischen Paradigmenwechsel, dennoch ist der eigene Geschmack oft recht beratungsresistent, und es kann durchaus herausfordernd sein, sich auch nur in Einzelheiten anders zu positionieren. Trotzdem ist der Versuch wichtig und ein Erfolg meistens lohnenswert, denn sich selbst an eine Situation anzupassen, ist in den meisten Fällen deutlich sozialverträglicher, zeiteffizienter und nebenwirkungsärmer, als stets Herrin über die Umstände sein zu wollen.
Mitnichten sollte dies übrigens jemals soweit gehen, dass man seine Persönlichkeit oder seinen Geschmack geradezu einebnet und maximaler spielerischer Kompatibilität und Gruppenharmonie zugunsten an den Grundsteinen der eigenen Mentalität und Individualität rüttelt. So erstrebenswert hundertprozentige Kompromissbereitschaft auch für das soziale Gefüge der Spielgruppe sein mag, letztlich ist niemandem damit gedient, wenn der persönliche Stil und die persönliche Note eines Rollenspielers geradezu neutralisiert werden. Unsere Begeisterung für das Rollenspiel hat schließlich auch viel mit unserer individuellen Herangehensweise an das Hobby zu tun. Nur wenn diese erhalten bleibt, können wir mit vollem Elan und Esprit Spieler oder Spielleiterin sein. Es geht also darum, sowohl die Bedürfnisse und Erfahrungen der anderen Spieler als auch die eigenen ernstzunehmen. Der vernünftigste Weg besteht – wie fast immer – im Kompromiss und dem Versuch, viel Toleranz, Verständnis und Kompatibilität zu zeigen, während man gleichzeitig die eigenen Anforderungen nicht aus dem Blick verliert. Zwar gibt es kein Zuviel an Verständnis, aber es gibt sicherlich ein Zuviel an Anpassung. Allerdings sind die meisten Rollenspielerinnen meiner Erfahrung nach weit davon entfernt, ihre höchsteigenen Eigenschaften und Ansichten für ein besseres Miteinander in der Gruppe aufzugeben. Viel eher tendieren sie zum anderen Extrem, nämlich bei der Bewertung von Spielsituationen gänzlich nur die eigenen und unhinterfragten Maßstäbe anzulegen. Und genau da ist ein Perspektivwechsel angesagt.

Wenn auch Gespräche nicht mehr helfen: Extremfälle
Bisher ging es hier ja um die Lösung von Problemen am Spieltisch – entweder durch gemeinsames Gespräch und Kompromisssuche oder durch Modifikation der eigenen Perspektive. Und ich bin überzeugt, dass sich die allermeisten Konflikte in Rollenspielgruppen auch auf einem dieser Wege lösen lassen, solange alle Beteiligten auch a) tatsächlich gerne rollenspielen wollen und b) auch tatsächlich mit eben diesen Mitspielern zusammenspielen und Teil einer Gruppe mit der entsprechenden Konstellation sein möchten. Doch es gibt Ausnahmefälle, nämlich Situationen, in denen das gemeinsame Spiel trotz noch so vieler und umsichtiger Bemühungen einfach nicht gerettet werden kann – und diese haben meiner Erfahrung nach immer wenigstens einen von drei möglichen Hintergründen: 1.) unvereinbare Geschmäcker hinsichtlich Regeln, Spielwelt oder Spielweise; 2.) wahrhaftig toxische Persönlichkeitsanteile bei einer oder mehreren Spielerinnen; 3.) das dringende Bedürfnis einer oder mehrerer Spielerinnen, selbst Spielleiterin zu werden.
Extremfall 1: Unvereinbare Geschmäcker
Leichte bis mittelstarke Abweichungen in den Vorlieben und Prioritäten hinsichtlich Rollenspiel-Regeln, Spielwelten, Spielinhalten und der schauspielerischen oder anderweitigen Vorgehenweise während des Spiels bestehen ohnehin nahezu immer zwischen den einzelnen Spielerinnen. An den gemeinsamen Spieltisch findet man dennoch, weil einfach eine ausreichend große Schnittmenge aus kompatiblen Bestandteilen gefunden werden kann. Hin und wieder müssen Spieler jedoch feststellen, dass ihre Geschmäcker geradezu diametral entgegengesetzt sind oder dass ihnen eine ganz spezifische Umsetzung einzelner Spielaspekte von enormer Wichtigkeit ist und hier kein Kompromiss mit den Sichtweisen der Mitspieler gefunden werden kann. Manchmal zeigen sich solche starken Unterschiede bereits früh – z. B. bei der Setting-Wahl, wo sich ein Teil der Gruppe vielleicht nichts Schöneres vorstellen kann als klassische pseudomittelalterliche Fantasy, während jedoch ein Mitglied Elfen, Zwerge, Orks und Drachen todlangweilig findet und Abenteuerplots um magische Gegenstände und modrige Verliese für unterfordernd naiv hält. Ob man da jemals auf einen vernünftigen Nenner kommen wird, ist fraglich. Bei diffizileren Geschmacksabweichungen mögen die auseinanderklaffenden Positionen hingegen erst nach mehreren gemeinsam bestrittenen Szenarien oder gar Kampagnen festgestellt werden – z. B., wenn eine Teilnehmerin simulierende Regelanteile wie Traglast, Nahrungsverwaltung, Krankheiten oder Charakterpsychologie partout nicht ausstehen kann, eine andere hingegen Feuer und Flamme für einen solchen lebensechteren Spielansatz ist. Bei dem ersten richtigen Reise- oder Wildnisabenteuer wird dieser Geschmackskonflikt dann plötzlich evident, und man muss erkennen, dass man das Hobby Rollenspiel doch auf jeweils sehr unterschiedliche Weise betreiben möchte.
Manchmal mag es in der Tat möglich sein, auch hier noch eine halbwegs zufriedenstellende Lösung zu finden. Im letztgenannten Fall könnte die Gruppe schlicht vereinbaren, auf ausgedehntere Reise- oder Wildnispassagen oder eine spieltechnische Simulation von Persönlichkeitsanteilen (z. B. Furcht) in ihren zukünftigen gemeinsamen Unternehmungen zu verzichten. Im ersten Fall wäre die Wahl eines Genres denkbar, dass sowohl dem Fantasy-Überdrüssigen als auch den Freunden klassischer Rollenspiel-Abenteuer gefällt; vielleicht entdecken ja beide Seiten, dass sie Spaß an einer pulpigen Action-Archäologie-Prämisse im Stile von Indiana Jones haben. Kann man sich so einigen, ist das erst mal gut, und dem Weiterspielen sollte in jedem Fall eine vollwertige Chance gegeben werden. Dennoch sollte im Hinterkopf behalten werden, dass die großen geschmacklichen Klüfte in den gelösten Fragen auch ein Indikator für mögliche weitere Abweichungen von entsprechender Tragweite sein können. Zwar ist jedes Geschmacksgefüge einer Person einzigartig, doch häufig gehen mit einer bestimmten Vorliebe oder Abneigung nun mal verwandte und wesensnahe Sichtweisen einher. Wer z. B. keine stärker simulierenden Spielsituationen mag, wird in den meisten Fällen auch kein Freund realistischer Kampfregeln sein, und wer sich von Fantasy angeödet fühlt, findet meistens auch am Fund legendärer Artefakte mit echten magischen Fähigkeiten keinen Gefallen.
Ob nun früh oder spät: Wenn man merkt, dass die rollenspielgeschmacklichen Paradigmen zu weit auseinanderliegen und sich das gemeinsame Spiel immer wieder an entsprechenden Divergenzen stößt, ohne dass ein längerfristiger Kompromiss gefunden werden kann, dann ist es die beste Wahl, sich als Spielgruppe zu trennen und solche Mitstreiter zu suchen, die dem jeweils eigenen Spielgeschmack näherstehen. Es ist besonders schade, wenn ein solcher Bruch mit Mitspielern geschieht, die man auch außerhalb des Spiels zu den Freunden zählt – doch andererseits wird möglicherweise so auch die Freundschaft geschont, wenn eben nicht stets wieder Woche für Woche oder Monat für Monat die Unvereinbarkeiten im Rollenspiel für Reibungsflächen sorgen.

Extremfall 2: Toxische Spieler
Jeder hat mal einen schlechten Tag. Jede ertappt sich mal dabei (oder wird ertappt), wie sie eigene Frustrationen an ihren Mitspielerinnen auslässt. Jeder sagt mal etwas Unüberlegtes oder Unangebrachtes. Zwar sollte jeder Mensch und im Speziellen auch jede Rollenspielerin stets an sich arbeiten und Persönlichkeitsausfälle gegenüber Mitmenschen nach Möglichkeit vermeiden, aber dennoch kann keiner von uns jederzeit vollkommen besonnen und vollkommen ausgeglichen sein. Daher ist es empfehlenswert, grundsätzlich ein gewisses Maß an Verständnis für die vereinzelte „miese Laune“ oder das ab und an störende Verhalten der Mit-Rollenspieler zu zeigen, vorausgesetzt, es handelt sich um ein vorübergehendes Phänomen von kurzer Dauer und es überschreitet gewisse Grenzen nicht. Größeres und umfassenderes Verständnis ist sicherlich zudem angebracht, wenn man weiß, dass eine Mitspielerin gerade eine schwere Zeit im realen Leben durchmacht. In solchen Fällen sollte es zu verschmerzen sein, wenn im Rollenspiel auch über eine gewisse Zeit hinweg nicht alles glattläuft.
Doch es gibt im Völkchen der Rollenspieler leider ein paar Typen, deren markante und problematische Persönlichkeitszüge nicht auf vorübergehenden Verstimmungen gründen, sondern wesentlich immanenter und dauerhafter ihr Wesen bestimmen. Hier spreche ich von toxischen Spielern, womit natürlich gleichermaßen toxische Spielleiterinnen gemeint sind. Das Sozialverhalten dieser Menschen wird zumeist bestimmt von stärker ausgeprägten narzisstischen Anteilen, wodurch sie immer wieder zu kontrollierenden, egoistischen, manipulativen, rücksichtslosen und sogar vorsätzlich verletzenden und destruktiven Episoden neigen.
Wie auch überall sonst im Leben sollte Narzissten in Rollenspielgruppen keinerlei Raum zur Entfaltung ihrer antisozialen Bestrebungen gegeben werden. Leider sind entsprechende Tendenzen gar nicht so selten, und unsere Gesellschaft wird sich erst jetzt so langsam ihrer tatsächlichen Prävalenz bewusst. Es ist manchmal gar nicht leicht, ein entsprechendes Profil zu identifizieren, daher liste ich im Folgenden einige Erkennungsmerkmale auf, die nach eigener Erfahrung auf einen narzisstischen Rollenspieler hinweisen können:
- Eine Person diskriminiert eine Mitspielerin oder stachelt andere zur Diskriminierung oder zum Mobbing direkt oder indirekt (!) an.
- Eine Person reagiert auf Spielweisen und Entscheidungen auf der In-game- wie Out-of-game-Ebene dauerhaft oder wiederkehrend trotzig und zynisch, also passiv-aggressiv.
- Eine Person versucht im Spiel ständig absolut maßgeblich und entscheidungstragend zu sein und ist sofort deutlich gelangweilt oder frustriert, wenn sie in bestimmten Situationen eher im Hintergrund steht oder auf indirekten Einfluss begrenzt ist.
- Eine Person geht nie oder so gut wie nie auf kooperierende oder interagierende Ansätzen anderer Spieler ein.
- Eine Person spielt andere Charaktere förmlich mit, indem sie sich immer wieder ungefragt in Handlungsentscheidungen, strategische oder taktische Abwägungen oder sogar die Charakterdarstellung einmischt.
- Ein Spieler äußert immer wieder direkt oder indirekt Kritik an der Spielleitung und hält sich für einen wesentlich besseren Spielleiter, möchte dies jedoch nicht offen sagen.
Diese und ähnliche Situationen sind Hinweise, wenn auch noch keine hunterprozentigen Beweise, es mit einem toxischen Spieler zu tun zu haben. Besteht der Verdacht, sollte im Normalfall dennoch erst mal der Weg des Gesprächs wie oben erläutert gesucht werden. Narzisstische Wesenszüge sind – wie gesagt – durchaus nicht selten, manche können jedoch gut über lange Zeit unterdrückt oder sogar im Laufe der Zeit abtrainiert werden. Konfrontierte Spieler, die Besserung geloben, können dies wirklich ernst meinen. Andererseits kann es sich auch um reine Scharade handeln, um leere Versprechungen, um ja nicht aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Auch Narzissten haben schließlich ein großes Bedürfnis nach sozialen Kontakten, auch wenn es ihnen letztlich nicht um ein gleichberechtigtes und harmonisches Miteinander, sondern um Kontrolle und Anerkennung geht. Hat die toxische Spielerin nicht zu sehr über die Stränge geschlagen, kann ihr sicherlich eine zweite Chance gegeben werden. Manchmal bessert sie sich wirklich. Aber wenigstens ebenso oft gibt es auch nach einer zweiten, dritten oder vielleicht vierten Chance einen Rückfall in die toxischen Verhaltensweisen. Irgendwann muss der Rest der Gruppe dann entscheiden, dass eine Grenze überschritten wurde und dass das Spiel mit der betreffenden Person nicht mehr möglich ist. Mit anderen Worten: dann muss die Person ausgeschlossen werden.
Es gibt einen Fall, in dem bereits eine zweite Chance zu großzügig und auch unfair gegenüber den jeweils anderen Mitspielern ist: Wird ein Teilnehmer direkt oder indirekt beleidigt oder diskriminiert, darf dies nicht hingenommen und schon gar nicht heruntergespielt oder eben überspielt werden. Folgt nicht wenigstens bis zur nächsten Spielsitzung eine Entschuldigung und eine tatsächliche starke Veränderung im Verhalten, sollte die verursachende Person aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Ein Gespräch über den Vorfall sollte selbst hier noch geschehen, doch verhält sich die Verursachende uneinsichtig und bleibt eine ernst gemeinte Entschuldigung aus, sollte mit einem Ausschluss nicht zu lange gewartet werden. Bei Personen, die auch außerhalb der Spielgruppe zum Freundeskreis zählen und mit denen man vielleicht auch schon lange bekannt ist, fällt es oft schwer, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Schließlich hat man eine gemeinsame Geschichte und ist Teil eines größeren sozialen Netzwerks. Doch es hilft nichts: Wer beleidigt oder diskriminiert, muss gestoppt werden, und das geht in Rollenspielgruppen oft nur, wenn die Verursacherin aus der Gruppe fliegt. Die Alternative wäre nämlich, dass man anderen Gruppenmitgliedern weiter zumutet, mit einer Person zusammenzuspielen, die sie niedergemacht oder bloßgestellt hat. Dies ist nicht zumutbar, und kein verantwortungsbewusster Rollenspieler sollte dies billigen.

Extremfall 3: Gruppenmeuterei
Wer lange genug und in mehreren verschiedenen Konstellationen rollengespielt hat, hat in wenigstens einer Gruppe sicherlich auch schon mal eine Art Machtkampf um das Amt der Spielleiterin erlebt. Selten findet dieser offen, direkt und transparent statt, sondern viel eher in Form von sich stetig mehrender Kritik an Spielleitungsstil und Spielinhalten, meistens angeregt durch eine bestimmte Person, aber mit dem Versuch, andere Mitspieler für die eigene Sichtweise zu gewinnen. Hier braut sich zusammen, was ich als „Gruppenmeuterei“ bezeichne, dem Versuch meistens einer, selten mehrerer Personen, Spielleiterin anstelle der Spielleiterin zu werden.
Dabei könnte alles so einfach sein: Mit etwas Zivilcourage könnte man der Gruppe einfach offen mitteilen, dass einem an der aktuellen Spielleitung und -gestaltung etwas nicht passt und dass man sich selbst für einen geeigneteren SL-Kandidaten hält. Hat man dazu sogar noch die oft vermisste Empathie, bespricht man das vielleicht zunächst am besten mit der gerade amtierenden Spielleiterin unter vier Augen, um sie nicht coram publico zu überrumpeln und sie mehr als nötig Scham und Minderwertigkeitsgefühlen auszusetzen.
Doch sowohl an Zivilcourage als auch an Empathie mangelt es Dauernörglern mit SL-Ambitionen oft. Anstatt zu ihrer Selbsteinschätzung als besserer SL zu stehen, instrumentalisieren sie den Rest der Gruppe, um Stimmung gegen die gerade aktive SL zu machen. Nicht selten klappt das auch, denn leider lassen sich viele Menschen (und daher leider auch viele Rollenspieler) recht leicht manipulieren. Wenn dann als Ergebnis dieser heimtückischen Bemühungen schließlich ein Großteil der Gruppe oder sogar die ganze Gruppe einen SL-Wechsel fordert, kann sich der Instigator dieser Meuterei fein damit herausreden, er habe doch nur den anderen Spielern helfen wollen, ehrlich ihre Sichtweise auszudrücken. Pustekuchen! Bei dieser ganz miesen Tour wird das vermeintliche Problem nur kreiert bzw. um ein Vielfaches aufgebläht und die Mitspieler letztlich als Erfüllungsgehilfen missbraucht. Wer nicht den Mumm und den Anstand hat, bei einem als dringlich empfundenen Spielleiterwechsel das Thema offen und am besten zunächst mit der SL persönlich anzuschneiden, der taugt vermutlich auch höchstens sehr eingeschränkt als Spielleiter – schließlich gehören Sozialkompetenz, Fairness und Transparenz zu den Meistertugenden dieses Amtes.
Per se spricht übrigens gar nichts dagegen, wenn eine Spielerin wirklich unzufrieden mit dem aktuellen Spiel bzw. der Spielleitung im Speziellen ist und sich für eine deutlich geeignetere Spielleiterin hält. Schön ist das für die aktuelle SL gewiss nicht, aber wenn wirklich ein authentischer Missstand wahrgenommen wird und wenn man wirklich überzeugt ist, dass man selbst es deutlich besser machen kann, dann darf dies selbstverständlich kommuniziert werden.
Diese beiden Bedingungen jedoch sollte man sich in jedem Fall noch mal auf der Zunge zergehen lassen, bevor man den SL-Wechsel anregt. Liegt gar kein halbwegs objektivierbarer Missstand vor, sondern nur eine Spielsituation oder Spielweise, die sich mit den eigenen hochspeziellen Ansichten oder Bedürfnissen nicht verträgt, dann ist sehr fraglich, ob man das Spiel wirklich für alle Spielerinnen besser machen möchte. Und dann ist da die Frage der Fähigkeit: Kann man es tatsächlich deutlich besser als die gerade spielleitende Person? Mit der Spielleitung wenig oder nur einseitig Vertraute beantworten diese Frage oft vorschnell mit „ja“, denn sie übersehen die Komplexität und den starken Abwägungscharakter, den die SL-Pflichten mit sich bringen. Vieles, was eine Spielleiterin entscheidet und vermittelt, basiert auf Kompromissen und Zugeständnissen an verschiedene Gesichtspunkte des Spiels. Manchmal mag sich eine Handhabung oder Äußerung der SL zunächst vielleicht etwas merkwürdig anfühlen oder gerade nicht den eigenen Erwartungen entsprechen, offenbart im Nachhinein jedoch einen tieferen Sinn und eine im Endeffekt gute Spielführung. Aus einer vorschnellen und unreflektierten Beurteilung entsteht nicht selten überhaupt erst der Verdacht, im Spiel wäre etwas faul oder die SL mache etwas falsch. Bei der Urteilsfindung ist also Vorsicht, Reflexion und eine gute Analyse des Spiels und der eigenen Fähigkeiten gefordert. Ist man dann immer noch der Überzeugung, dass das Spiel stark verbesserungsbedürftig und man selbst zu dieser Verbesserung in der Lage sei, dann kann man guten Gewissens den Wechsel anregen – doch eben nicht durch Manipulation oder Instrumentalisierung anderer Spieler, sondern aufrichtig, zur eigenen Meinung stehend und am besten so höflich und mit soviel Feingefühl wie möglich.
Was nun aber tun, wenn man eben keine ehrlichen und geradlinigen Kritiker, sondern ein oder mehrere Meuterer und SL-Thronräuber in seiner Gruppe hat? Je nach Gruppenklima, Seitenbildung, gekränktem Stolz und Anmaßungsgebahren kann eine Rollenspielgruppe leicht an solchen Aktionen zerbrechen. Doch dieses Schicksal ist sogar oft besser, als mit intriganten Persönlichkeiten weiterhin den Spieltisch zu teilen und bei jeder neuen Spielsitzung mit Frustration und Minderwertigkeitsgefühlen kämpfen zu müssen. Von letzteren Begleiterscheinung ist natürlich gerade die abgesetzte Spielleiterin betroffen, und sie muss sich fragen, ob sie den Rollentausch letztlich akzeptieren kann. In keinem Fall sollte man intrigant und manipulativ agierende Rollenspieler gänzlich ungeschoren davonkommen lassen: Es sollte zur verbalen Konfrontation und einer deutlichen Exponierung ihres Missverhaltens kommen. Waren sie nur übereifrig und entschuldigen sich aufrichtig, mag ein gewisser Gruppenfrieden wiederhergestellt werden, der möglicherweise ausreicht, um das Spiel in irgendeiner Form weiterzuführen. Letztlich lässt sich aber feststellen, dass jede Rollenspielerin, die ihre persönlichen Ziele innerhalb der Gruppe durch Instrumentalisierung anderer oder des Spiels selbst zu erreichen versucht, narzisstische und toxische Tendenzen (wie im vorigen Abschnitt beschrieben) aufweist. Nicht nur die bisherige Spielleiterin, sondern jede Teilnehmerin der Gruppe sollte sich daher ernsthaft fragen, ob sie der betreffenden Person eine weitere Chance geben möchte. Toxisches Verhalten ist nämlich für gewöhnlich nicht auf einen bestimmten Anlass – wie einen machiavellistischen SL-Sturz – beschränkt, sondern zeigt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in anderen Ausformungen im späteren Spiel. Die beste Lösung für die entthronte SL und solche Spielerinnen, die sich ungern zu Werkzeugen für das Ego anderer machen lassen, besteht vermutlich also darin, eine neue Rollenspielgruppe ohne den Usurpator zu gründen. Soll dieser doch gleichzeitig seine eigene Runde mit den Spielern abhalten, die gerne nach seiner Pfeife tanzen. Die Chancen stehen gut, dass auch diese irgendwann aus der Verblendung erwachen und die wahren Motivationen des Demagogen erkennen: Selbstüberschätzung und Geltungssucht.
Meistens gibt es einen Weg.
Auch auf den Vorwurf hin, ich wolle diesem Artikel unbedingt zum Schluss eine positive Note verleihen, ziehe ich dennoch das Resümee, dass im Großteil aller rollenspielerischen Problemfälle eine Lösung gefunden werden kann – und zwar eine Lösung, für die kein Mitglied die Gruppe verlassen muss und die alle zufrieden genug stimmt, um das gemeinsame Spiel unterm Strich gerne fortzusetzen. Manchmal sind für eine solche Lösung allerdings auch recht ungewöhnliche Schritte nötig, z. B. einen häufigeren SL-Wechsel zu etablieren oder die gespielten Kampagnen auf eine jeweils maximale Zahl von Sitzungen zu beschränken, um für eine entsprechende Abwechslung und die Berücksichtigung stärker abweichender Geschmäcker zu sorgen.
Aufgezeigt wurden ja die Grenzen solcher Bemühungen, nämlich, wenn einzelne Teilnehmer sich verletzend, rücksichtlos oder kontrollierend gegenüber anderen Mitgliedern verhalten und uneinsichtig und zu keiner Besserung bereit sind. Ferner gibt es Geschmäcker und Sichtweisen, die einfach zu weit auseinanderliegen, um den nötigen gemeinsamen Nenner finden zu können. Auch wenn es aus anderen Gründen schwerfällt, sollte hier eine Trennung oder eine personelle Umgestaltung der Gruppe ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Übrigens musst dies nicht zwangsweise bedeuten, dass man mit bestimmten Personen dann „nie wieder“ rollenspielt. Manchmal ändern sich bestimmte Individuen im Laufe der Zeit tatsächlich, und es kann bei einer zukünftigen Kampagne vielleicht wieder zueinandergefunden werden.
Immer wichtig ist, dass Probleme oder Konflikte im Rollenspiel nicht ignoriert, geleugnet oder überspielt werden. Sobald eine Mitspielerin eine Situation oder ein Verhalten als so unangenehm oder störend empfindet, dass sie darüber den Spaß am Spiel verliert, muss dieser Sachverhalt thematisiert werden und sollte für jedes Gruppenmitglied von zentraler Bedeutung sein. Kleine Frustrationen über schlechte Würfelwürfe, über das Misslingen eines Vorhabens oder über die eigenwillige Spielweise einer Mitspielerin in einem vereinzelten Fall sind hiermit selbstverständlich nicht gemeint. Zum gewöhnlichen Rollenspiel-Alltag gehören nun mal manche Höhen und Tiefen, Spannendes, Langweiliges und manchmal auch Enttäuschendes sowie eine gehörige Portion erwartbarer Kompromissbereitschaft und Toleranz gegenüber abweichenden Sichtweisen und Spielansätzen. Nicht dazu gehören dürfen allerdings echte und längerfristige Schwierigkeiten, die einzelnen (oder allen) Teilnehmern die Begeisterung für das Rollenspiel nehmen.

Habt Ihr Gedanken oder Anmerkungen zu diesem Artikel? Teilt diese gerne in den Kommentaren weiter unten.
Dieser Artikel nimmt an der Blogparade zum Thema Drama im Rollenspiel – Lachen, Weinen, Lieben und Betrügen teil, die von den Blogger-Kollegen bei Würfellustbarkeit.de und Rollenspielblog.net ausgerichtet wird. Der Start-Artikel zur Aktion kann hier gelesen werden: https://rollenspielblog.net/rollenspiel/drama-blogparade-start. Herzlichen Dank für die schöne Idee!


Danke fürs Mitmachen bei der Blogparade!
Ich finde es schön, mal einen Artikel zu lesen, der ein Thema nicht nur oberflächlich behandelt, sondern richtig in die Tiefe geht. Und es gibt soo viel zu entpacken in deinem Text.
Besonders ins Auge gesprungen ist mir die Passage: Logikprobleme ansprechen ohne in Besserwisserei abzugleiten. Ein schwieriges Unterfangen, finde ich. Dein Vorschlag, vor der Fremdkritik erstmal Selbstkritik zu üben, und sich zu fragen, ob das jetzt hilfreich sein wird, was man sagen möchte, ist vermutlich der einzig gangbare Weg. „Erst denken, dann reden“, ist halt nicht ohne Grund eine tradierte Weisheit.
(Und, nur als Kleinigkeit nebenbei: Ich weiß gute Beispiele immer besonders zu schätzen, weil es mich selbst viel Mühe kostet, welche zu finden. Das Kodak/Polaroid-Beispiel ist hervorragend! Hut ab.)
Ich mag auch die Feststellung: Wer keine Zeit „opfern“ möchte, um klärende Gespräche zu führen, ist entweder selbst Teil des Problems oder steht der Problemlösung im Weg. Das ermutigt mich dabei, wirklich drauf zu bestehen, Probleme zu diskutieren, selbst wenn das initial auf Widerstand stößt.
Wenn mir was in deinem Artikel fehlt, dann ist das die Erwähnung von Safety Tools. Die sind zwar keine Wunderwerkzeuge, die alle Probleme verhindern. Aber im Fall der X-Karte nimmt mir das z.B. die Arbeit ab, bevor etwas anspreche, das mich stört, erstmal mühsamm überlegen zu müssen, wie ich das jetzt formulieren soll. Stattdessen liegt: „Ich möchte das x-en“, immer bereit.
Danke für den Kommentar! Ja, die „X-Karte“ hätte noch berücksichtigt werden können, das stimmt.