Anders als oft behauptet, tragen Spieler meiner Erfahrung nach genauso viel Verantwortung für das Gelingen (oder Misslingen) einer Rollenspielsitzung wie die Spielleiterin – manchmal sogar mehr. In diesem Artikel betrachte ich genauer, worin die Spielerverantwortung besteht und mache Vorschläge zur Umsetzung am Spieltisch.
Die Spielleiterin ist keine Alleinunterhalterin.
Sehr oft, wenn das Rollenspiel Neueinsteigern erläutert wird – sei es in einem Regelwerk, einem Video-Tutorial oder in persona von einer erfahrenen Betreiberin – wird die Spielleiterin als wichtigstes Mitglied einer Rollenspielgruppe herausgestellt. Sie bereitet schließlich alles vor, gestaltet die einzelnen Abenteuer und den gesamten Kampagnenrahmen, führt sämtliche NSC und entscheidet über alle Ergebnisse der SC-Handlungen und alle Reaktionen der Spielwelt. Da kann sich schnell der Eindruck aufdrängen, die Spielleiterin sei eine Alleinunterhalterin mit der das gesamte Programm steht und fällt, und die Spieler seien hauptsächlich Rezipienten, nicht unähnlich dem Publikum einer Theateraufführung. Wenn das Dargebotene spannend, interessant, überraschend oder anderweitig erfreulich ist, wird ihr applaudiert und sie wird ob ihrer kreativen Fähigkeiten gelobt. War der Spielabend hingegen langatmig, zäh, vorhersehbar oder gar frustrierend, hagelt es Kritik – entweder direkt und offen nach der Sitzung oder eher längerfristig und ausgebreitet über einen Teil der Kampagne hinweg in Form von spitzen Bemerkungen und Zynismus. Vielleicht kündigt ein Spieler gar seine Teilnahme auf, mit der Begründung „dieses Spiel sei nichts für ihn“ oder „die Kampagne habe ihn nicht abgeholt“.
Zu solchen Verhaltensmustern neigen freilich nicht nur Neueinsteiger, sondern auch durchaus manch ein Spieler mit Jahrzehnten Spielerfahrung. Schließlich halten sich Perspektiven hartnäckig, manchmal lebenslang, ohne durch ernsthaftere Reflexion in Frage gestellt zu werden. Die Konsumentenhaltung ist meiner Erfahrung nach weit verbreitet in der Spielerschaft: Viele Spieler tauchen zu Spielterminen mit der Erwartung auf, hier etwas „geboten“ zu bekommen. Und im Idealfall ist das natürlich die nahezu unrealistische Kombination aus den Qualitäten guter linearer Medien (Stichwort „eine mitreißende Story“) mit der vollumfänglichen Entscheidungsfreiheit des echten Lebens. Passt etwas nicht, liegt es natürlich an der Spielleiterin…
Schuld an dieser unilateralen Spieleinstellung ist sicherlich oft ein Mangel an Kontemplation und Selbstanalyse, doch einen wesentlichen Anteil tragen auch all jene Einführungen in das Hobby, welche die Aufgaben sowie die Verantwortung der Spielleiterin hinsichtlich des De-facto-Erlebnisses am Tisch zu sehr in den Fokus stellen. Außer acht lassen sie nämlich, dass die Spieler nicht nur die Hauptfiguren der Kampagne verkörpern, sondern dabei auch zu einem wesentlichen Teil als Mit-Regisseur und Mit-Autor der Spielsitzung tätig sind. Welche Teile eines Abenteuers oder der Spielwelt während der Sitzung betrachtet werden und wie viel Zeit mit einem bestimmten Handlungs- oder Hintergrundelement verbracht wird, ist oft mehr von den Entscheidungen, Vorgehensweisen und Spielstilen der Spieler als von den Einflussmöglichkeiten der Spielleiterin abhängig.
Vordergründig sollte allen Rollenspielern klar sein, dass die Handlungsentscheidungen der Spieler den Spielverlauf vorantreiben. Der Spieler sagt, was er macht, die Spielleiterin beschreibt daraufhin, welche Auswirkungen diese Handlung hat und wie die Umgebung und eventuelle NSC darauf reagieren. Genau dieses von der Spielerhandlung angestoßene Wechselspiel ist ja essenziell Rollenspiel. Nicht berücksichtigt wird dabei oft (oder sogar meistens?), dass Entscheidungen und Handlungsansagen der Spieler mitnichten rein dem persönlichen Geschmack geschuldete Spieltätigkeiten sind oder nur Einfluss auf Aspekte der spielinternen Ebene haben; vielmehr bedingen und konstituieren sie stark das effektive Spielerlebnis der gesamten Spielgruppe während der jeweiligen Sitzung, manchmal sogar darüber hinausgehend während des jeweiligen Kampagnenabschnitts. Was also ein einzelner SC, mehrere SC oder alle SC auf einmal tun, ist zu einem guten Teil mitverantwortlich für den weiteren Spielinhalt. Dies kann gerade dann sehr deutliche kurzfristige Auswirkungen haben, wenn für den jeweiligen Spieltermin ein eher knapper Zeitrahmen (weniger als 4 Stunden) besteht. Stößt beispielsweise ein Spieler eine länger dauernde Diskussion mit NSC an, ist die dafür nötige Zeit für alle Teilnehmer „geblockt“ – selbst, wenn ihre eigenen Charaktere bei dem Gespräch nicht anwesend sein sollten. Dies ist vielleicht kein Problem oder sogar angenehm, wenn die anderen Teilnehmerinnen ausgiebige In-game-Gespräche mögen und außerdem gerne anderen zuhören. Legen gewisse Mitspieler allerdings weniger Wert auf dialogreiche Passagen oder sind ungern längere Zeit inaktiv, dann kann man eine solche Situation durchaus als problematisch bezeichnen. Denn dann führt die Handlungsentscheidung eines Spielers bzw. SC dazu, dass ein wesentlicher Teil der Spielzeit für etwas aufgewandt wird, das einem oder mehreren anderen Teilnehmern keine Freunde bereitet oder für sie sogar langweilig ist.
Sicherlich kann man hier zu Recht einwerfen, dass für die Teilnahme an einer Rollenspielgruppe – wie letztlich bei den meisten Gruppenaktivitäten – ein gewisses Maß an Geduld, Kompromissbereitschaft und Frustrationstoleranz eine Grundvoraussetzung darstellen sollte. Dieser Sichtweise schließe ich mich an, möchte aber andererseits zu bedenken geben, dass längst nicht jede Gruppe in der privilegierten Position ist, ihre Teilnehmer aus einem großen personellen Fundus an entweder besonders ausgeglichenen oder eben spielgeschmacklich ähnlich orientieren Mitstreiterinnen rekrutieren zu können. Mit anderen Worten: In den meisten Gruppen sind ein oder mehrere Spieler, die im Rollenspiel andere Bestandteile favorisieren als ihre Tischkollegen, und es sind nicht selten auch solche darunter, die mit längeren Wartezeiten schlecht umgehen können. Ebenso wie solche Gruppenmitglieder gut mit einem gewissen Geduldstraining beraten wären, sind die anderen Teilnehmer in solchen Fällen zur Rücksicht aufgerufen: Vielleicht ist ein Kompromiss möglich, der die Spielsituation für alle Teilnehmer gut erträglich gestalten könnte. In dem Beispiel des längeren NSC-Gesprächs wäre eine bewusst durch den Spieler gewählte Verknappung oder Zusammenfassung mancher Passagen denkbar. Auch ein Verzicht auf die Einbringung nicht zentraler Zusatzthemen oder die wiederholte detaillierte Zurschaustellung von SC-Persönlichkeitsfacetten kann sehr wirksam sein.
In jedem Fall liegt die Verantwortung in solchen und ähnlichen Situationen bei den Spielern. Was sie ihre SC tun lassen, hat eben nicht nur Konsequenzen in der fiktiven Spielwelt, sondern auch deutlich konkreter für die Abendgestaltung ihrer Mitspieler. Oder übersehe ich hier etwa den Auftrag der Spielleiterin, moderierend einzugreifen und durch erzwungene Abkürzungen, Umblenden und Szenenwechsel alle gleichermaßen bei Laune zu halten?

Die Spielleiterin ist keine Kindergärtnerin.
Nun, dass eine Spielleiterin zu einem gewissen Grad auch Moderatorin sein muss, steht außer Frage. Vor allem betrifft diese Moderationsaufgabe allerdings das Verhältnis aus Spielertätigkeiten einerseits und Regeln und Spielwelt andererseits. Direkter gesagt: Sie muss das Spiel moderieren, nicht (unbedingt) ihre Spieler. De facto werden sich Spielleiterinnen jedoch recht häufig in der Position wiederfinden, zwischen Spielerinteressen zu vermitteln oder gar zu schlichten – einfach weil sonst das Spiel droht, aus den Fugen zu geraten. Genau hier jedoch setze ich mit meinem Aufruf an und fordere: Spieler, übernehmt mehr Verantwortung, sowohl für Euch selbst als auch für die anderen Teilnehmer in Eurer Gruppe!
Die Spielleiterin hat mit der Verwaltung von Regelsystem, Welt, Kampagne und Abenteuern sowie der Umsetzungen von SC-Handlungen wirklich genug zu tun. Zusätzlich verpflichtend darauf achten zu müssen, dass jeder Spieler auf seine hochindividuellen Kosten kommt, von der Spielumgebung oft genug direkt involviert wird und außerdem immer eine gleichmäßige „Screentime“ erhält, wäre ohne Übertreibung eine Zumutung! Außerdem ist eine solche pädagogisch-artifizielle Spielführung gar nicht im tatsächlichen Interesse der meisten Spieler. Die meisten Spieler legen nämlich großen Wert auf einen Spielaspekt, der sich mit stärkeren Fremdeingriffen in die selbst gewählte Spielweise überhaupt nicht gut vertragen will: Freiheit. Selbst zu entscheiden, was man tut und wie man genau dabei vorgeht, gehört zu den essenziellen Eigenschaften eines Rollenspiels und unterscheidet es fundamental von den sehr begrenzten und klar aufgezeigten Handlungsalternativen in Brett- und anderen Spielen. Da mag es einen schon wurmen, wenn die Spielleiterin in einen 15-minütigen Monolog hineingrätscht oder etwas schnell und abstrakt handhabt, was man gerne in vollem Detail ausgespielt oder regeltechnisch mikrosimuliert hätte. Das Zauberwort hier heißt also nicht Beschränkung, sondern: Selbstbeschränkung, mit einer deutlichen Betonung auf „Selbst“.
So schön und künstlerisch hochwertig es einerseits ist, sich so oft wie möglich voll und ganz in seinen Charakter hineinzuversetzen, oder so befriedigend es andererseits auch sein mag, gewisse Spielsituationen mit großer Ausführlichkeit und perfekter regeltechnischer Präzision umzusetzen – ein verantwortungsbewusster und damit letztlich auch guter Spieler macht sich immer auch die Personen auf der Meta-Ebene und ihre Bedürfnisse bewusst. Gefällt die aktuelle Spielszene auch den anderen Teilnehmern, ist es vielleicht okay, sie noch etwas zu verlängern, oder wäre es vielleicht besser, sich kurz zu fassen, damit man zu einem anderen Spielabschnitt übergehen kann? Die Verantwortung für ein gelingendes spielerisches Miteinander und auch ein gelingendes Gesamterlebnis allein oder auch nur hauptsächlich bei der Spielleiterin zu suchen, ist nicht nur egoistisch, sondern verkennt auch die wahren Hintergründe, Ursachen und Strukturen, die über die Qualität und – direkt gesagt – den „Spaßfaktor“ einer Rollenspielsitzung entscheiden.

Verantwortung ohne Freiheitsverzicht
Die stärkere Inkorporation von Spielerautonomie, also der größeren Einflussmöglichkeit des Spielers auf das Spiel über die Grenzen der eigenen Charakterperspektive hinaus, wird in der Rollenspielszene zumeist als erstrebenswert und „guter Stil“ dargestellt. Die viel zu wenig beachtete Kehrseite dieser Münze ist jedoch Spielerverantwortung: Selbstmoderation, durchaus auch Selbstbeschränkung, das Bewusstmachen des großen eigenen Einflusses auf das Gesamterlebnis und vor allem die Aufmerksamkeit gegenüber den anderen Teilnehmern – den Mitspielern wie auch der Spielleiterin – und deren Anforderungen an das gemeinsame Spiel.
Verantwortung, Gebote und Beschränkungen sind verständlicherweise deutlich weniger attraktiv als mehr Einfluss und mehr Selbstbestimmung; für ein verlässlich gutes Spielerlebnis und ein funktionales Gruppenverhältnis sind sie jedoch meiner Meinung nach deutlich entscheidender. Gleichzeitig muss diese größere Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen Spielstil nicht zwangsläufig bedeuten, dass man weniger Entscheidungs- oder Handlungsfreiheit genießt. Vielmehr geht es bei meiner Betrachtung ja mehr um die Art und Weise, wie etwas im Spiel umgesetzt wird, als um die gewählte Handlungsoption selbst. Möchte beispielsweise ein Spieler, dass sein SC während einer Reise zum Abenteuerort ausgiebig nach Kräutern sucht, dann lässt sich dieses Vorhaben bei entsprechender Vorbereitung und einem Verzicht auf Sonderwünsche oder detailliert geschilderte Einzelschritte sicherlich auch mit ein paar Würfelwürfen relativ schnell abwickeln. Die angesprochene Vorbereitung sollte jedoch eben nicht bei der Spielleiterin hängen bleiben, vielmehr sollte der Spieler selbst Initiative zeigen. Wer z. B. einen Charakter mit einer entsprechend guten Kräuterkunde-Fertigkeit führt und bereits weiß, dass dieser im Laufe des Spiels mehrfach die Natur-Apotheke nach potenten Mitteln durchforsten soll, der verhält sich dann verantwortungsvoll, wenn er den für die Kräutersuche geltenden Regelbestandteil bereits selbständig vorbereitet – soweit möglich natürlich. Unklarheiten oder spielweltspezifische Fragen werden umsichtigerweise außerhalb des Spiels mit der Spielleiterin abgesprochen. Während der Spielsitzung muss dann nur noch das vorher spielfertig präparierte Verfahren in die Tat umgesetzt werden. Ein paar klare Ansagen, ein paar erforderliche Würfelwürfe und dann noch ein schnelles Ablesen aus den bereitliegenden Tabellen. So kann die Suche nach Kräutern in jeweils wenigen Minuten erledigt sein und artet nicht in eine halb- oder vielleicht gar ganzstündige Regelsuch- und Diskussions-Eskapade aus, die möglicherweise allen außer dem Kräuterkundler ordentlich auf die Nerven geht und die der eigentlichen geplanten gemeinsamen Erkundung des Geisterverlieses einen beträchtlichen Anteil Spielzeit raubt.
Spieler können vieles tun, um das Spiel für die gesamte Gruppe flüssiger und fokussierter zu gestalten und der Spielleiterin einiges an Arbeit abzunehmen. Und sie können – wie veranschaulicht – durch einfache Modifikationen ihrer Handlungsweisen oder auch durch den Verzicht auf manche spielerisch nicht sehr relevante, dafür aber zeitraubende, Nebentätigkeiten das Gesamterlebnis für alle optimieren. Noch nicht angesprochen wurde jedoch, dass Spieler auch sehr effektiv die Spielmotivation steigern können und dadurch sogar eigentlich mäßig spannende oder von der Spielleitung vielleicht etwas holperig oder unbeholfen dargebotene Abenteuer in eine unterhaltsame, spannende und atmosphärische Episode verwandeln können. Das Zauberwort hier heißt „Proaktivität“. Anstatt darauf zu warten, „vom Abenteuer abgeholt“ zu werden, sorgen verantwortungsbewusste Spieler von sich aus dafür, dass sich ihre SC für die Spielinhalte interessieren und sich entsprechend engagieren.
Wer glaubt, er sei ein guter Rollenspieler, wenn er sein Charakterkonzept mit analytischer Genauigkeit daraufhin überprüft, ob die gerade von der SL vorgestellten Plot Hooks auch wirklich zu der intendierten Persönlichkeit des eigenen Protagonisten passen, den muss ich an dieser Stelle enttäuschen – ein solch kleinlich verengter Blickwinkel hat in einer kollaborativen Gruppenaktivität wie dem Rollenspiel nichts verloren. Neben der an und für sich zuträglichen Perspektive der „rollengerechten“ Darstellung ist nämlich der Aspekt der Aufrechterhaltung der Spieldynamik noch deutlich bedeutsamer. Kompromissloses Method Acting mit Tunnelblick befriedigt vielleicht den eigenen Kunstfimmel, ist für das Zusammenspiel mit den anderen Teilnehmern aber eher hinderlich als förderlich. Schon die einer solchen Spielweise zugrunde liegende Erwartungshaltung ist sowohl realitätsfremd als auch anmaßend: Keine Spielleiterin kann nämlich bei noch so sorgfältiger Planung gewährleisten, dass stets sämtliche Aufgaben und Herausforderungen eines Abenteuers perfekt zu den individuellen Interessenschwerpunkten und Wesenszügen jedes einzelnen SC passen. Und selbst wenn eine solch großmeisterliche Plotschreiberin tatsächlich existieren würde – die resultierenden Abenteuer wären unter diesen Voraussetzungen vermutlich allesamt recht ähnlich und einseitig und die Kampagne insgesamt recht schnell vorbei. Abwechslungsreichtum und eine sinnvoll lange Kampagnen-Laufzeit setzen einfach voraus, dass in Sachen Glaubwürdigkeit und getreuer Darstellung der Hauptfiguren gewisse Zugeständnisse an den spielerischen Rahmen gemacht werden. Konkreter gesagt: Eine Spielleiterin muss voraussetzen dürfen, dass ihre Spieler trotz vielleicht gewisser Unstimmigkeiten zwischen Abenteuer- und Charaktermotivation vor allem danach streben, den Ball am Laufen zu halten. Auch wenn der äußerst naturverbundene Druide nicht gerade erpicht darauf sein mag, bei einer längeren Stadtepisode mitzumischen, sollte sein Spieler trotzdem einen Grund finden, warum er mit vollem Einsatz dabei ist. Gerne darf dies so ausgespielt werden, dass er nebenher seinen Unmut über die urbane Lebensweise kundtut und ein paar belehrende Worte für den ein oder anderen NSC parat hat. Genau eine solche „Trotzdem-Haltung“ kennzeichnet gerade einen guter Rollenspieler: Er schafft es, eine gruppen- und handlungsorientierte Spielweise mit markanter Charakterdarstellung zu verbinden. Das Beste beider Welten also!
Doch proaktives Spielen sollte nicht nur bedeuten, dass die SC verlässlich den sprichwörtlichen roten Faden aufnehmen. Das ist viel mehr eine Grundvoraussetzung. Im weiteren Verlauf von Abenteuern mag es immer mal wieder zu Situationen kommen, in denen etwas spielerischer Leerlauf vorliegt. Vielleicht haben die SC die falschen Schlüsse gezogen oder den falschen Ort aufgesucht, vielleicht haben Würfelwürfe oder Spielentscheidungen dazu geführt, dass sich die Gruppe in eine ungünstige Lage gebracht hat, oder vielleicht hat das Abenteuer schlicht ein paar Längen, nicht vollständig durchdachte Passagen oder die Spielleiterin eine schlechten Tag, der ihr keine Möglichkeit zur Vorbereitung gegeben hat. Wenig verantwortungsbewusste Spieler äußern schnell ihr Missfallen – entweder direkt von Spieler zu Spielleiterin oder indirekt durch trotziges oder gehässiges SC-Verhalten. Dabei sind sie sich entweder nicht im Klaren darüber oder es ist ihnen gar egal, dass gerade eine solche Reaktionsweise erst recht dazu führt, dass die jeweilige Spielsituation für alle besonders unangenehm wird und das Abenteuer vielleicht gar zu scheitern droht. Gute Spieler hingegen sehen in langweiligen oder anderweitig suboptimalen Spielsituationen einen Aufruf, selbst aktiver zu werden und fehlende Abenteuermotivation durch interessantes Charakterspiel, verstärkte In-game-Interaktion mit ihren SC-Kollegen (oder vorhandenen NSC) oder die Anregung gemeinschaftlichen Planens und Problematisierens zu ersetzen.
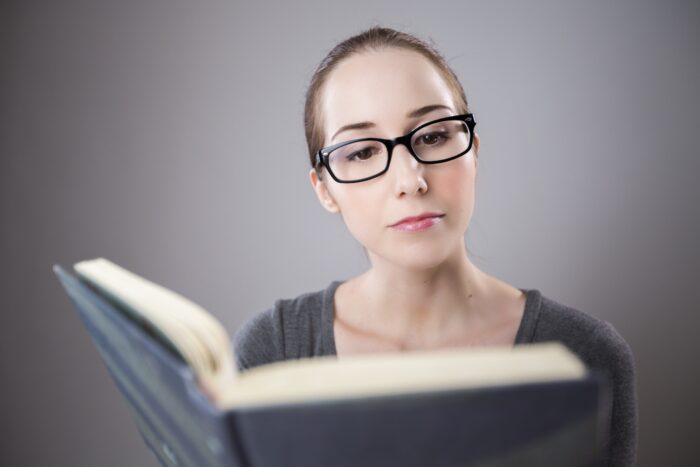
Beide Seiten kennenlernen
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass es in den Verantwortungsbereich von Spielern fällt, die Spielgestaltung zu unterstützen. Schwächen in der Handlung oder in der Spielleitung sollten niemals ausgenutzt oder sofort kritisiert, sondern durch die eigene Charakterführung überspielt und so indirekt optimiert werden.
Eine Aufmerksamkeit dafür, wie man die Spielgestaltung am besten unterstützen kann und welche tatsächliche Aufgaben und Vorgehensweisen die Rolle der Spielleiterin involviert, erhält ein Spieler am besten, indem er dieses Amt selbst hin und wieder übernimmt. Während die meisten Rollenspieler wohl hauptsächlich oder sogar ausschließlich Spielleiterin oder eben Spielerin sind, trägt gerade der häufigere Seitenwechsel dazu bei, die Voraussetzungen für ein gelingendes Rollenspiel in seiner Gänze zu verstehen und sich immer wieder bewusst zu machen. Denn auch, wenn man ein gutes Einschätzungsvermögen und gute Menschenkenntnis zu haben glaubt, so gehört die Spielleitung bei Rollenspielen ganz klar zu den Tätigkeiten, die zwar nach außen hin leicht nachvollziehbar wirken, doch tatsächlich viele Abwägungen und Nuancen beinhalten, die vollständig nur bei eigener aktiver Ausführung erkennbar werden.
Diese Empfehlung muss jedoch mitnichten bedeuten, dass man eine etablierte und gut funktionierende Teilnehmerkonstellation nun zwangsweise ummodifizieren und Spielleitung grundsätzlich zur Teilzeit-Aufgabe umwandeln sollte. Vielmehr schlage ich vor, dass solche Spieler, die nur sehr selten oder noch gar nicht als Spielleiter aktiv waren, nebenher kleine (oder größere) Rollenspiel-Nebenprojekte starten, in denen sie selbst die Spielleitung übernehmen. Auch ein Spielleiter-Wechsel mit jeder abgeschlossenen Kampagne ist denkbar, wenn alle Teilnehmerinnen damit einverstanden sind. Natürlich sorgt ein Wechsel pro Abenteuer für noch regeren Rollentausch, doch nicht alle Spieler mögen die dadurch entstehenden Besonderheiten bei der Charakter-Gruppenkonstellation und der zum Gemeinschaftsprojekt werdenden Kampagnengestaltung.
Wie auch immer es bewerkstelligt wird, hin und wieder auf die andere Seite des SL-Schirms zu wechseln, ist für jeden Teilnehmer und für die Gruppe als Ganzes eine bereichernde Erfahrung. Übrigens gilt dies selbstverständlich auch für den Wechsel von der Spielleiterin hin zur Spielerin, denn nicht nur Dauer-Spieler, sondern auch Dauer-Spielleiter neigen zur Fehleinschätzung der jeweils anderen Perspektive, sind z. T. gar mit der von ihnen geschaffenen Kampagne so „verheiratet“, dass sie die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Spielergemeinde aus dem Blick verlieren.

Gleichmäßige Verantwortung
Die Quintessenz ist, dass die Verantwortung für eine gelingende Rollenspiel-Kampagne und für jede einzelne gelingende Spielsitzung bei allen Teilnehmern gleichermaßen liegt. Dies mag vielleicht selbstverständlich klingen, entspricht allerdings überhaupt nicht den Schilderungen in den allermeisten Leitfäden und Ratgebern zur Spielleitung und meines Erachtens auch nicht den üblichen Erwartungshaltungen der meisten neuen und auch vieler erfahrener Rollenspieler. Das prozentuale Verhältnis von SL- zu Spielerverantwortung wird da eher als 80 zu 20 oder vielleicht 70 zu 30 eingeschätzt und der Spielleiterin im Zweifelsfall recht klar die Hauptschuld für mögliche Probleme in der Gruppendynamik, der Abenteuerdramaturgie oder der regeltechnischen Umsetzung von Spielsituationen zugeschoben. Erfahrungsgemäß beträgt das Verantwortungsverhältnis aber in den allermeisten Situationen klare 50 zu 50. Wenn es überhaupt mal ein Mehr an Verantworuntg gibt, dann würde ich dies häufiger auf Seiten der Spieler beziffern, zumal diese – wie oben beschrieben – einen deutlich größeren Anteil an der konkreten Entscheidung haben, welcher Handlungsaspekt gerade im Fokus des Spiels steht und wie dieser angegangen wird. Daher komme ich hier also zu folgendem Resümee: Spieler tragen immer große Mitverantwortung für das Gelingen von Spielsitzungen und Kampagnen – im Zweifelsfall zu 51 %.
Stimmt Ihr zu, widersprecht Ihr, oder seht Ihr die Sache ganz anders? Schreibt mir gerne Kommentare, ich freue mich immer über Diskussion.


Sehr guter Artikel, der viel Wesentliches vom guten Spielen umfasst. Bravo!
Herzlichen Dank, das freut mich sehr! Ich war mir nicht sicher, ob manche der Vorschläge und Aufrufe nicht vielleicht etwas zu moralisierend daherkommen, aber die Sache war mir einfach eine Herzensangelegenheit.